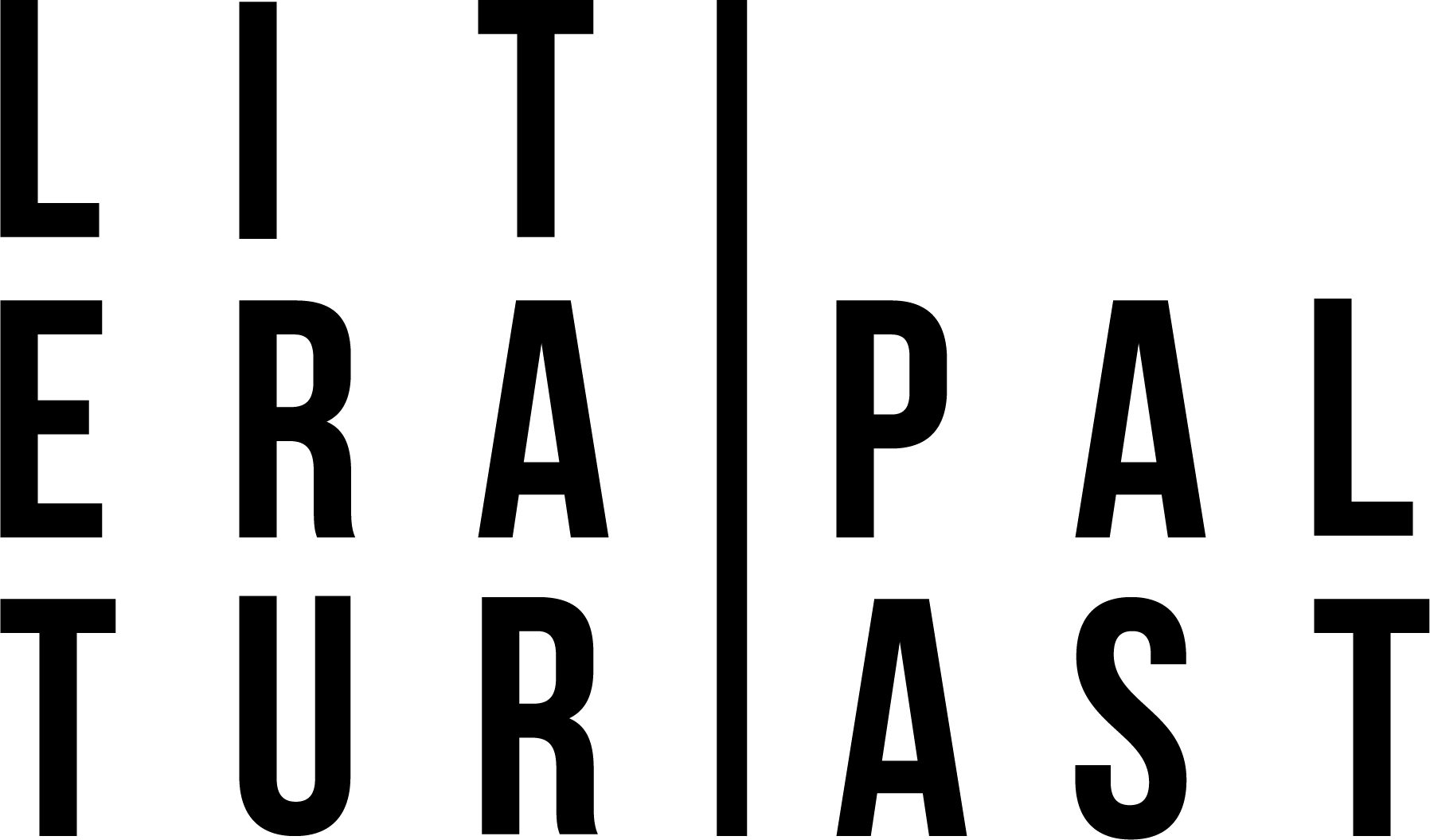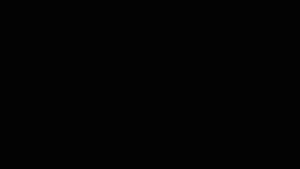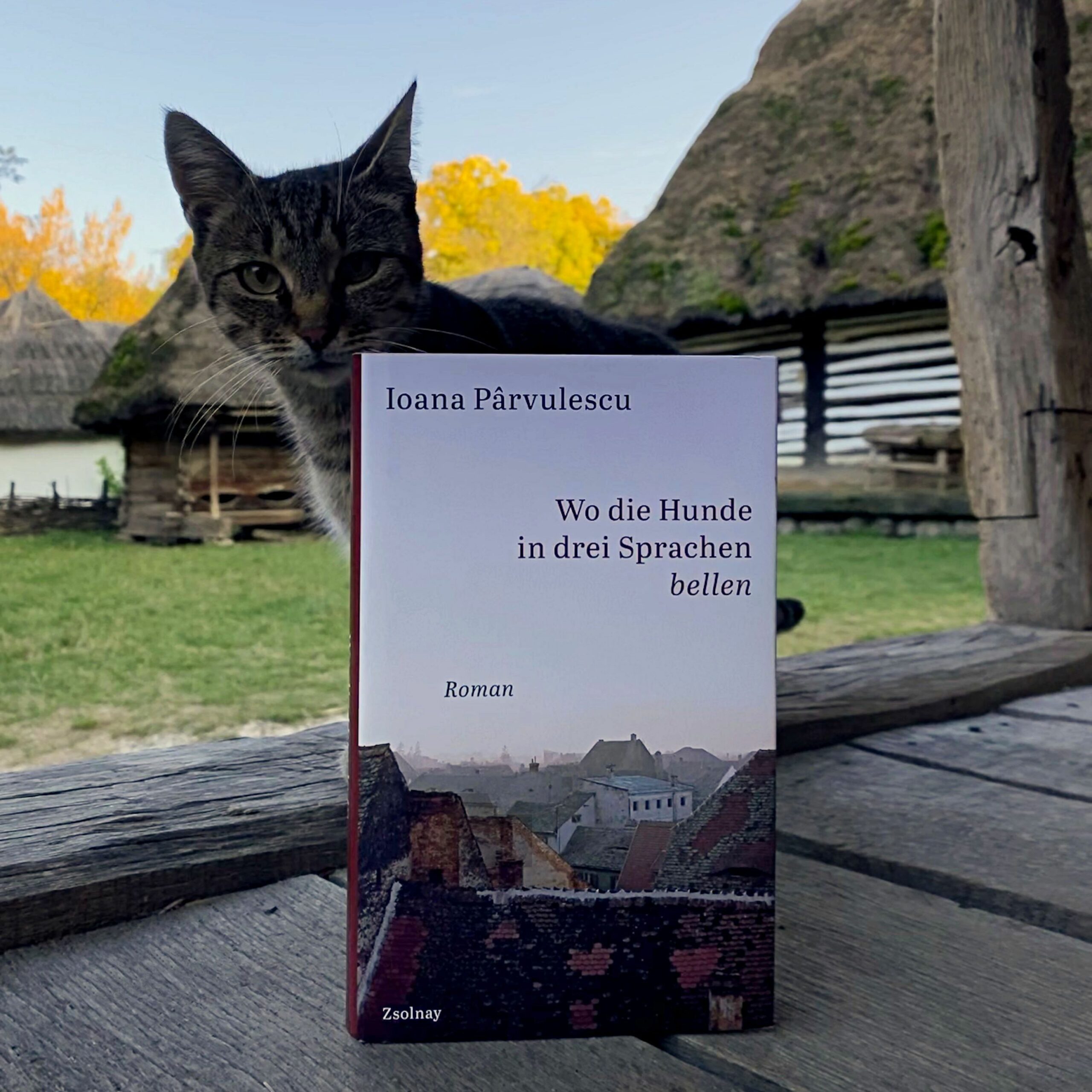
Über das Vergessen
Vor Jahren stieß ich durch einen Zufall auf einen Artikel von Patrik Süßkind, in dem sich der bekannt-unbekannte Autor des Parfums vergangenen Lektüren widmet – oder genauer: seiner mangelnden Erinnerung an das Gelesene. In besagtem Text betrachtet er seine großzügig eingerichtete Bibliothek, streift durch die Reihen und entdeckt viele Klassiker der Weltliteratur, die er einst verschlugen hat. Worum es aber in diesen Büchern geht, wovon sie konkret erzählen, das hat er völlig vergessen – und das nahezu bei allen gelesenen Werken.
Süßkinds Text war für mich eine große Erleichterung und ist es noch immer. Ich habe Kolleginnen und Kollegen im Wissenschafts- und Literaturbetrieb, die sich kenntnisreich und elaboriert über Texte unterhalten können, die sie vor einer halben Ewigkeit gelesen haben. Zu dieser Gattung Mensch gehöre ich leider nicht. Ich merke mir einzelne Szenen und Bilder, die eine oder andere Figur, ein gewisse Stimmung – alles andere vergesse ich aber im Grunde sofort. Für Besprechungen oder Moderationen streiche ich daher vorsorglich viel an und mache mir Notizen. Anders geht’s nicht.
Mein marodes Textgedächtnis macht mich nicht glücklich, hält mich aber auch nicht von der Arbeit ab. Zum Problem (vielleicht ist der Begriff zu groß gewählt) wird die Sache erst, wenn sich Veranstaltungen oder Aufnahmen stark nach hinten verschieben: Termine kollidieren, die Podcast-Technik streikt, jemand wird krank – das kann immer wieder passieren, meist renkt es sich schon irgendwie ein. Bislang gab es nur einen Fall, da hat es einfach nicht sollen sein.

Als ich im Herbst 2021 einige Wochen in Bukarest verbrachte, wollte ich mich mit der rumänischen Autorin Ioana Pârvulescu treffen, um mit ihr über ihren Roman Wo die Hunde in drei Sprachen bellen – übersetzt von Georg Aescht – zu sprechen. Das Buch war damals frisch im Zsolnay Verlag erschienen, ich hatte es mit auf meine Reise genommen und aufmerksam gelesen. Nach einem Telefonat mit Pârvulescu, in dem wir mögliche Gesprächstermine durchgingen, lief dann jedoch alles schief. Zunächst kam ich nicht an Mikrofone, weil eine befreundete Redakteurin nicht zu erreichen war, dann konnte mir das Goethe Institut keinen Raum für die Aufnahme zur Verfügung stellen und als sich doch noch eine Möglichkeit ergab, erkrankte Pârvulescu an Corona. Kurzum: Wir nahmen mehrere Anläufe, das Ganze zog sich über Monate, letztendlich kam es aber nie zu einer Podcastfolge mit der Autorin.
So etwas ist natürlich frustrierend. Ich hatte viel Zeit investiert, stand am Ende aber ohne Beitrag da. Irgendwann war die Sache für mich einfach gegessen. Ich hatte nicht einmal mehr Lust, eine Besprechung des Romans zu verfassen. Andererseits war’s schade um die ganze Arbeit. Nicht nur hatte ich das Buch gelesen und herbstliche Photos in einem Freilichtmuseum in Bukarest gemacht; ich war sogar für einen Tag nach Brașov gereist, um mir den Ort anzusehen, in dem Pârvulescu aufgewachsen ist und in dem auch ihr Roman spielt.
Was hielt mich also davon ab, einen schriftlichen Beitrag anzufertigen, wenn aus der Podcast-Folge schon nichts wurde? Die Antwort liegt natürlich auf der Hand: In der Zwischenzeit hatte ich völlig vergessen, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Ein autobiographischer Text, ein Buch über Mehrsprachigkeit und über das Aufwachsen im sozialistischen Rumänien, das wusste ich schon noch, aber viel zu wenige Details, um darüber zu schreiben. Ich würde mir den Roman ein weiteres Mal ansehen, zumindest meine Anstreichungen und Notizen überfliegen müssen. Nach etwa zweieinhalb Jahren interessiert mich dann doch, was und wie viel ich aus meinem Gedächtnis hervorholen kann. Bevor ich dies tue, folgt jedoch ein kleiner Exkurs mit Reiseimpressionen aus Brașov. Because … why not?

Notizen aus Brașov
1
Braşov ist von Bukarest aus sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Vom Gara de Nord, der nicht weit von meiner Wohnung entfernt ist, benötigt man etwa zweieinhalb Stunden. Auf das Streckennetz der rumänischen Bahn ist Verlass, die Waggons sind gemütlich, nur eilig sollte man es nicht haben.
2
Vor dem Fenster weicht die weite Walachei den Bergen. Ab und an tauchen Bauernhöfe auf, die so aussehen, als wäre die Zeit im frühen 20. Jahrhundert stehengeblieben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich zwischen den Bäumen keinen Karpatenbären erblicke.
3
Das Telefon sagt: Braşov in Siebenbürgen hatte viele Namen. Corona, Stephanopolis, Kronstadt und noch ein paar mehr. 1960, dem Geburtsjahr Pârvulescus, trug die Stadt den Namen Orașul Stalin (Stalinstadt).
4
Der Bahnhof von Braşov ist hell und modern. Es gibt in der Eingangshalle einen dieser Buchautomaten, aus dem man sich für wenig Geld obskure Publikationen ziehen kann. Wie es sich gehört, flackert in der Unterführung zu den Gleisen das Licht. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Der Roman Soldaten von Adrian Schiop, dessen deutschsprachige Ausgabe ich im Frühjahr 2023 herausgeben werde, beginnt mit einer Szene am Bahnhof von Braşov: „Sehr betrunken hatte ich einem armen Schlucker vom Kronstädter Bahnhof 50 Lei gegeben, damit er mich seinen Schwanz lutschen ließ.“
5
Im Bus in die Innenstadt lutsche ich ein Eis.


6
Im Bus in die Innenstadt lausche ich den Stimmen um mich herum. Eine kleine Gruppe von Männern unterhält sich laut auf Deutsch – Sprachmelodie und -rhythmus lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um Rumänen bzw. Siebenbürger Sachsen handeln muss.
7
Schon aus der Ferne erkenne ich den großen Schriftzug über der Stadt am Berg Tâmpa. Ein umgemünztes Hollywood-Sign: der Name der Stadt Braşov in großen Lettern. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll (eigentlich finde ich es plump).
8
Das Zentrum der Stadt ist überraschend pittoresk. Die Sonne scheint, die vielen Gassen und Plätze sind an diesem warmen Herbsttag sehr belebt. Gemeinsam mit Kleinfamilien und Rentnerpärchen absolviere ich einen Hindernisparcours durch die Touristenfallen.
9
Google Maps lotst mich in ein Restaurant am Rande der Altstadt. Das Lokal ist furchtbar folkloristisch ausgeschmückt, die Kellnerin aber sehr freundlich. Leider ist ihr Englisch so schlecht, dass ich eine halbe Ewigkeit benötige, um meine Bestellung aufzugeben. Sie versteht mich einfach nicht. Wenig später höre ich sie mit ihrer Kollegin in der Küche plaudern. Auf Deutsch.
10
Drei Absacker in drei verschiedenen Kneipen. Dann aber zum Bahnhof und zurück nach Bukarest. Es ist mittlerweile so dunkel, so dass ich die Landschaft vor dem Zugfenster nicht mehr erkennen kann. Also wieder kein Karpatenbär…


Multilinguale Hunde
Verweilen wir zunächst bei den Tieren. Ioana Pârvulescu – die zu den bekanntesten und beliebtesten Autorinnen Rumäniens zählt – gab ihrem autobiographischen Roman den Namen Inocenții, was auf Deutsch „Die Unschuldigen“ bedeutet. Ein großer Titel, in dem zwar die Kindheit mitschwingt, die so häufig mit der Unschuld assoziiert wird, doch ein Titel, der grundsätzlich eher vage daherkommt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich der Zsolnay Verlag für die deutschsprachige Ausgabe für einen anderen Titel entschieden hat. Die Wahl fiel auf Wo die Hunde in drei Sprachen bellen – eine Wendung, die sich in ähnlicher Form auch im Roman findet. Sie verweist u. a. auf das Thema der Mehrsprachigkeit (hier: rumänisch, deutsch, ungarisch), aber auch auf einen fernen, märchenhaft „anderen“ Ort, der sich maßgeblich vom Lebensmittelpunkt der deutschsprachigen Leserinnen und Leser unterscheiden mag. Dem Titel ist somit eine Exotisierung bzw. ein Othering eingeschrieben, die man meines Erachtens hätte vermeiden können.
Der unzeitgemäße Titel der deutschsprachigen Ausgabe soll nicht davon ablenken, dass das Buch selbst hervorragend von Georg Aescht übersetzt wurde – was mir just in diesem Moment auch von einer rumänischen Bekannten bestätigt wird, die beide Ausgaben kennt (ich hatte sie vorab um die Übersetzung des Wortes „Inocenții“ gebeten). Der Roman ist überhaupt sehr gut gearbeitet. Man merkt sehr schnell, dass es sich bei Pârvulescu um eine versierte Autorin handelt, die ihr Handwerk versteht. Figuren und Orte weiß sie plastisch und lebensnah zu zeichnen, vom Leben in Braşov und Siebenbürgen erzählt sie eindringlich. Interessiert man sich für die Geschichte der Region, ist man hier sehr gut aufgehoben. Mir selbst war das jedoch zu wenig.
Dieses seltsame Gedächtnis. Ich habe so viele Aspekte des Romans längst vergessen, andere hingegen sind mir ganz gegenwärtig. Auch ohne das Buch aufzuschlagen, kann ich mich gut an den Anfang des Romans erinnern, der in gewisser Weise ein Versprechen gibt, das er dann nicht einlöst. So verkündet der Prolog – verheißungsvoll mit dem Begriff Warnung betitelt, wie ich jetzt sehe, meine Aufzeichnungen längst nutzend –, dass sich die nun folgenden Begebenheiten in einer anderen Welt zugetragen haben: „Nicht nur die Geschichte, die das Alltagsleben der Menschen im Hintergrund webt, war eine andere, auch die Gegenstände, die ihre Handlungen bestimmen, waren anders.“
Untermauert wird diese Aussage mit einer kleinen Kulturgeschichte des Telefons. Ein wirklich interessanter Einstieg, der Kommunikationstechnik und mediengeschichtliche Umbrüche ins Spiel bringt und einen Hinweis auf Poetologie und Programmatik des Textes geben könnte. Aber das ist nicht der Fall. Denn was dann folgt, ist reiner Kulturpessimismus: Früher war alles besser, die Kinder hatten auch ohne Computer und Smartphones ihren Spaß, Langeweile kannten sie nicht. Die Leserinnen und Leser von Ioana Pârvulescu jedoch lernen die Langeweile auf den rund 350 Seiten des Romans sehr wohl kennen.
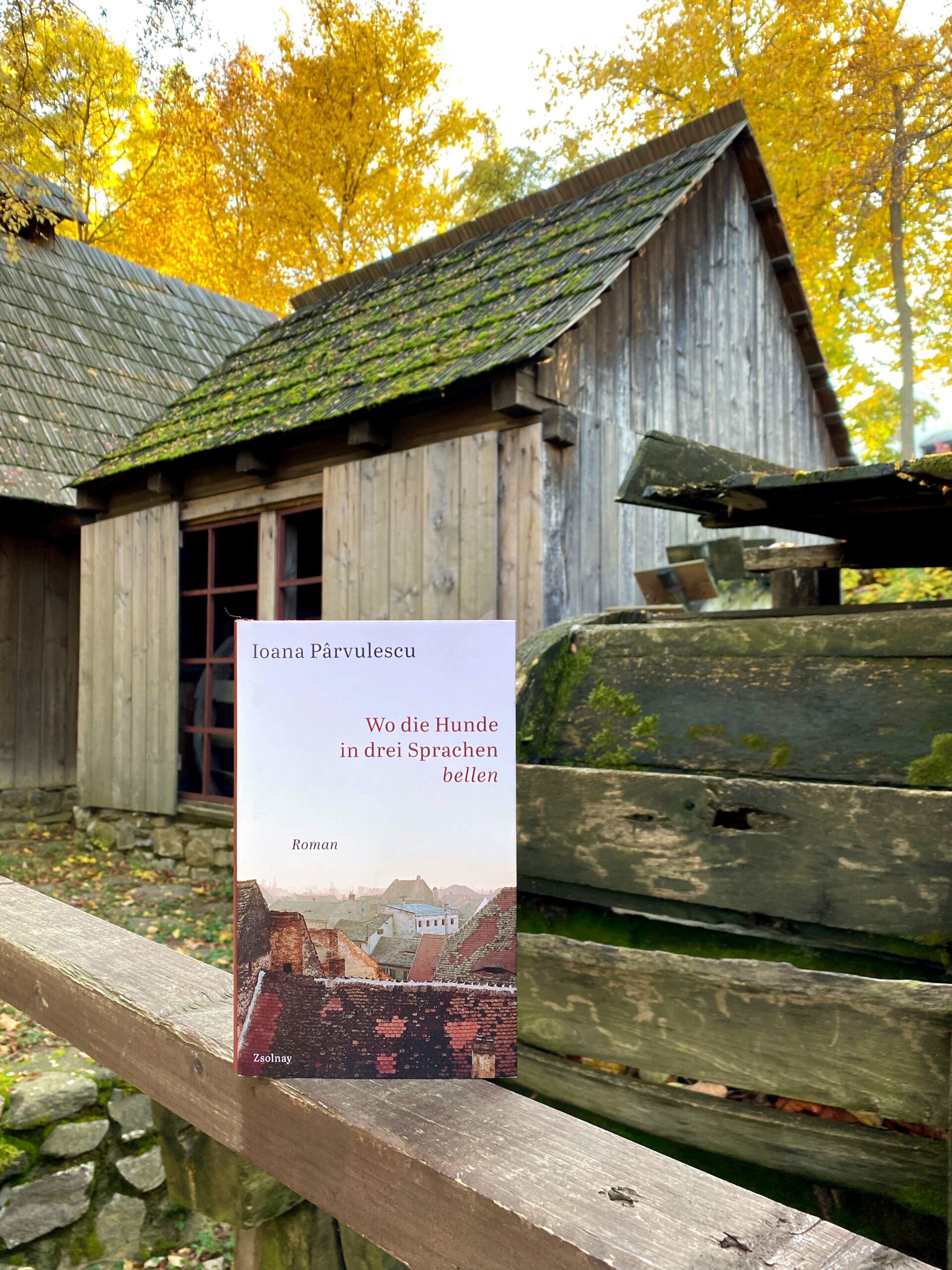
Eine klassische Familiengeschichte also, unaufdringlich und mit konventionellen Mitteln erzählt, vielleicht ein bisschen altbacken. Das kann man mögen. Because … why not? Doch gemessen an den vielen Formexperimenten und stilistischen Wagnissen autobiographischer Literatur – man denke (nicht) nur an die zahlreichen autofiktionalen Texte der letzten Jahre –, weiß Pârvulescus Roman nicht zu überzeugen. Sie scheut jedes erzählerisches Risiko. Hinzu kommt, dass ihr Buch nicht frei von Gemeinplätzen und Kalenderweisheiten ist und wiederholt ins Betuliche kippt – insbesondere an denjenigen Stellen, an denen sich die Ich-Erzählerin Ana mit Formulierungen wie „Lass dir erzählen“ direkt an die Lesenden wendet.
Besagte Ich-Erzählerin Ana berichtet rückblickend und episodenhaft von ihrer Kindheit in Braşov, vornehmlich in den 1960er Jahren. Eine Handlung im klassischen Sinne gibt es nicht. Das hat den Nachteil, dass sich der Inhalt des Romans nicht kurz und bündig wiedergeben lässt, aber den großen Vorteil, dass Pârvulescu hier wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und unterschiedlichste Themen anbringen kann. Und das tut sie auch. Sie lenkt den Blick – oszillierend zwischen einer erwachsenen und kindlichen Perspektive – auf viele kleine Geschichten und Anekdoten, die den Alltag einer deutschen Familie in Siebenbürgen einfangen. Kindliche Spiele und Geheimnisse, verstohlene Lektüren und Ausflüge in die Berge oder an das Schwarze Meer spielen dabei ebenso eine Rolle wie gesellschaftliche und politische Ereignisse, Erfahrungen von Familienangehörigen im Arbeitslager, Enteignungen und die immer wieder aufkeimenden Gedanken an Flucht und Ausreise.
Viele Punkte, die Ioana Pârvulescu in ihrem Roman berührt, sind interessant und von Belang. Sie schafft damit eine hervorragende Grundlage für ein Gespräch, ob nun auf der Bühne oder im Rahmen eines Podcasts. Ein mitreißender Roman ist ihr in meinen Augen mit Wo die Hunde in drei Sprachen bellen dennoch nicht gelungen. Denn abgesehen von den althergebrachten erzählerischen Mitteln, leidet der Text unter seiner Materialfülle. Sie wird ihm zur Last. Zu viele Episoden verlaufen ins Leere, zahlreiche Details blähen das Buch unnötig auf. Sie sind mitunter hübscher Zierrat, als solcher aber auch ziemlich leicht zu vergessen…