
”„Ich hatte gedacht, man braucht nur von diesen paar Menschen zu erzählen, die zufälligerweise meine Verwandten waren, und schon hat man das ganze zwanzigste Jahrhundert in der Tasche.“
Katja PetrowskajaVielleicht Esther
Einen Anfang finden, immer wieder einen Anfang finden. Eine stete Reise, eine fortlaufende Bewegung. Unzählige Bahnhöfe und Straßen, Namen und Adressen. Jeder Weg eine Fährte. Taschen und Koffer gepackt, darin verstaut auch ein klares Bewusstsein darüber, dass am Ende dieser Suche keine greifbaren Resultate stehen werden. Kein Ende finden, immer wieder kein Ende finden.
Vielleicht Esther (Suhrkamp Verlag, 2014) der ukrainisch-deutschen Schriftstellerin Katja Petrowskaja ist ein Buch der Annäherung. Bereits der Titel des autobiographischen Romans macht deutlich, dass es darin nicht um letztgültige Antworten geht, nicht gehen kann. Zu trügerisch sind die Erinnerungen, zu ungenau die Quellen, wichtige Gesprächspartner:innen längst nicht mehr lebendig. Die Familiengeschichte, der sich der Roman widmet, besteht in weiten Teilen aus Mutmaßungen, Spekulationen und Legenden und ist womöglich gerade deshalb als exemplarisch zu begreifen. Ob die titelgebende Urgroßmutter der Protagonistin – im Jahr 1941 in Kyjiw verschleppt und beim Massaker von Babij Jar ermordet – wirklich Esther hieß, ist völlig ungewiss.
Das Buch lässt diese Leerstellen zu, geht ihnen nach, erkundet den Raum zwischen allzu vagen Punkten. Kontingenz, Uneindeutigkeit und Nichtwissen schreiben sich in den Text ein und bestimmen seine Anlage und Form. Viele Erzählstränge – oder auch: die Lebensläufe einzelner Familienmitglieder – verlaufen ins Leere oder brechen vorzeitig ab, durch Krankheiten, Kriege, die Shoah oder die totalitaristischen Regime des 20. Jahrhunderts (naiv und wirklichkeitsfern hatten wir an ihr Ende geglaubt). Eine einheitliche, sinnstiftende oder gar große Erzählung ist nicht möglich; auch deshalb trägt Vielleicht Esther die kleine Genrebezeichnung „Geschichten“. Vielleicht.
”„Manchmal hatte ich das Gefühl, ich bewege mich durch den Baumüll der Geschichte. Nicht nur meine Suche, sondern auch mein Leben wurde allmählich sinnlos. Ich wollte zu viele Tote ins Leben zurückrufen und hatte dafür keine durchdachte Strategie. Ich las zufällige Bücher, ich reiste durch zufällige Städte und machte dabei unnötige, sogar falsche Bewegungen.“
Katja PetrowskajaVielleicht Esther

Die vermeintlich unnötige, sogar falsche Bewegung der Protagonistin beginnt am Berliner Hauptbahnhof, einem der „unwirtlichsten Orte in unserem kreuz und quer vereinigten und doch sehr begrenzten Europa“. Ihre Reise führt sie im Verlauf des Buches gleich mehrfach nach Polen, durch die Ukraine, nach Moskau und Österreich – an Orte, an denen enge oder entfernte Angehörige gelebt und gearbeitet haben, an Orte, an denen jüdische Familienmitglieder interniert und ermordet wurden. Rastlos besucht sie Museen, Archive und Dokumentationsstellen, Konzentrations- und Vernichtungslager und fühlt sich oft ohnmächtig ob der Fülle des Materials: „Ich sah kein Ornament, nur kleine Fetzen, uneheliche Kinder, nie gehörte Namen, verlorene Fäden, unnötige Details.“
Die Suche wird der Ich-Erzählerin zur Sucht und macht sie zur Getriebenen, die sich nicht von ihrem Gegenstand lösen kann. Die Versuche, mit dem Sichten und Lesen aufzuhören, scheitern kläglich. So wie auch die Vergangenheit (und der Zugang zu dieser) stets scheitern muss: „Die Vergangenheit betrog meine Erwartungen, sie entschlüpfte meinen Händen und beging einen Fauxpas nach dem anderen“, heißt es an einer Stelle.
Vielleicht Esther ist nicht der erste Roman, der das Verschwinden der Geschichte und die Unzulänglichkeiten der Erinnerung problematisiert und dabei die Spurensuche selbst in den Fokus rückt. Bemerkenswert ist jedoch die Sprache, die das Buch für die Erinnerungsarbeit findet. Die Bilder sind so präzise wie poetisch, die Metaphern lebendig, frei von Plattitüden. Erstaunlich ist dabei, wie sich die Sprache der Erzählerin zu ihrer Familiengeschichte verhält: Über mehrere Generationen hinweg arbeitete ein Großteil ihrer Verwandtschaft im Bereich der Logopädie und betrieb Schulen und Waisenhäuser für taubstumme Kinder. Gestik und Gebärden blieben auch denjenigen Familienmitgliedern erhalten, die dies nicht mehr taten.
Um sich ihrem Gegenstand annähern und die Arbeit am Text aufnehmen zu können, musste sich die Ich-Erzählerin gewissermaßen selbst einer „Sprecherziehung“ unterziehen. Mit Ende 20 lernt ihr Bruder Hebräisch, sie entscheidet sich für das Deutsche, das sie gerade deshalb so liebt, weil sie nicht damit verschmelzen kann. Deutsch, Немецкий, leitet sich im Russischen (und weiteren slawischen Sprachen) vom urslawischen Begriff für „stumm“ ab. Es ist die Sprache der Stummen. Es ist hier, vielleicht nur hier, die Sprache, die einen Anfang ermöglicht.
”„Dieses Deutsch war mir eine Wünschelrute auf der Suche nach den Meinigen, die jahrhundertelang taubstummen Kindern das Sprechen beigebracht hatten, also müsste ich das stumme Deutsch lernen, um sprechen zu können, und dieser Wunsch war mir unerklärlich.“
Katja PetrowskajaVielleicht Esther

[Die Photos für diesen Beitrag entstanden im September 2021 auf dem Jüdischen Freidhof im ukrainischen Czernowitz/Tscherniwzi.]
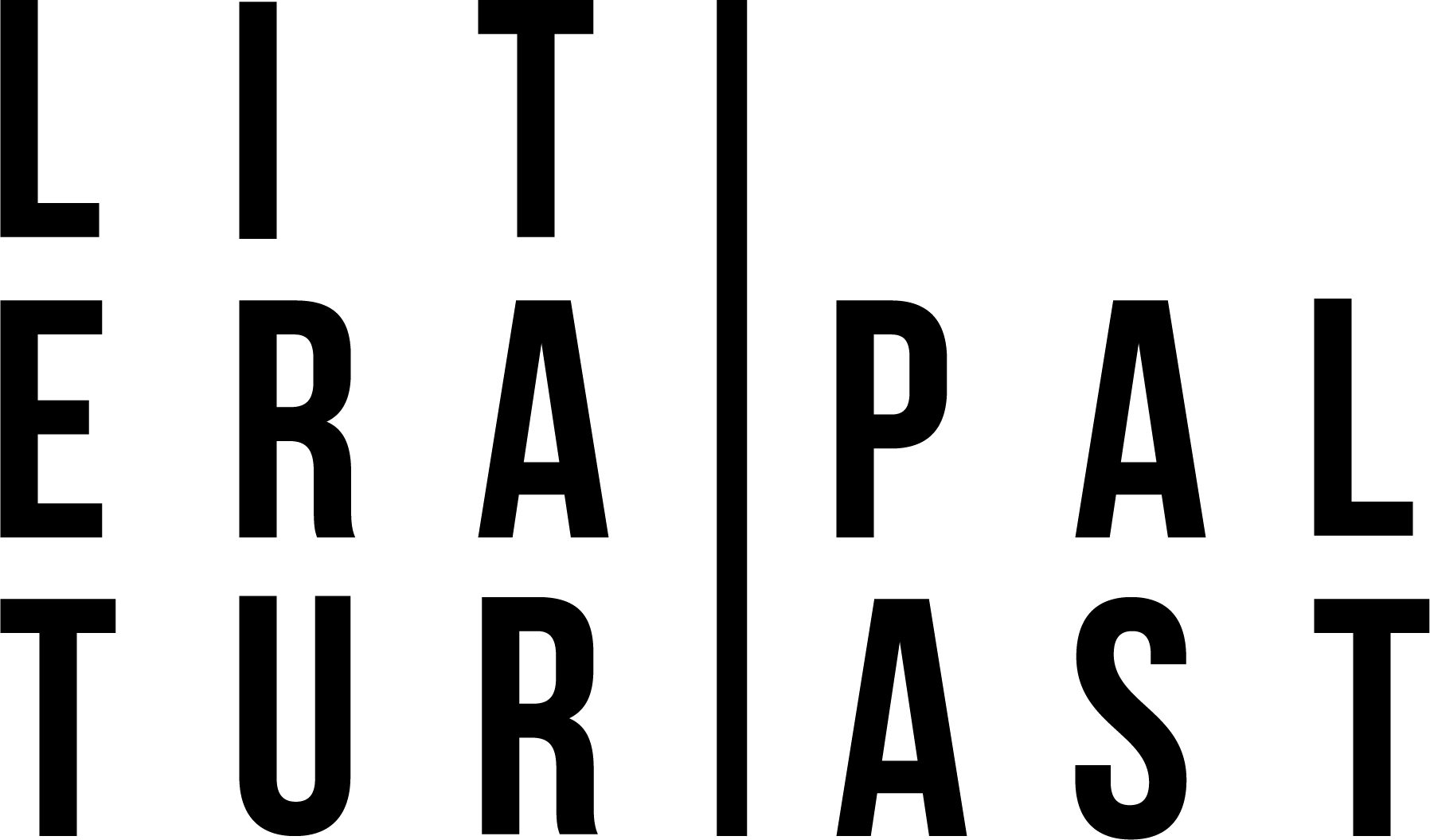
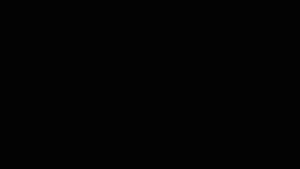
Das Buch „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja ist ein autobiografischer Roman über die Familiengeschichte der Autorin, die sich über mehrere Generationen hinweg in verschiedenen Ländern abspielt. Die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich schwierig, da viele Erzählstränge ins Leere laufen und wichtige Gesprächspartner nicht mehr am Leben sind. Doch trotz dieser Leerstellen schafft es die Autorin, eine poetische Sprache zu finden, die die Leser:innen in den Bann zieht.