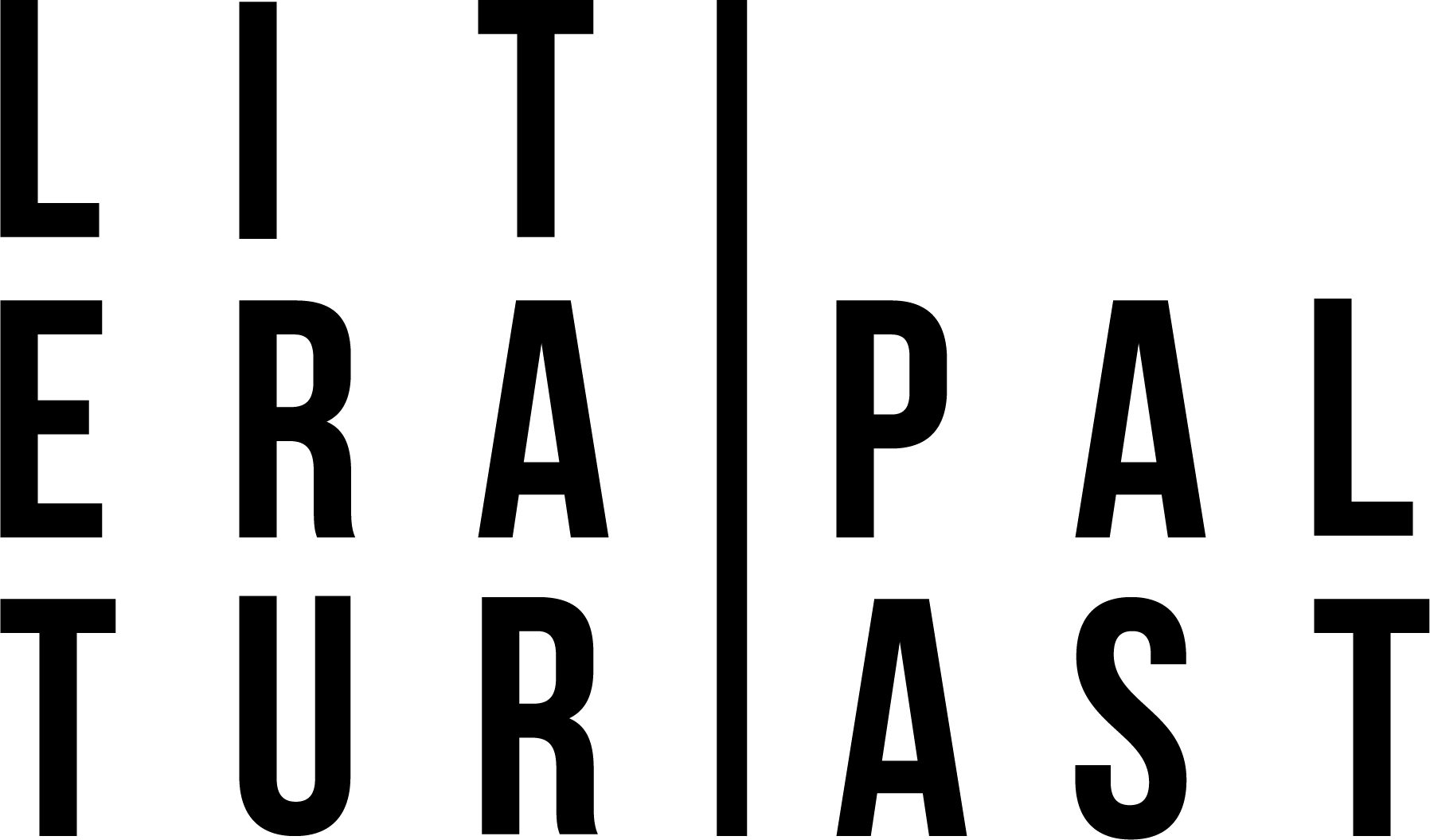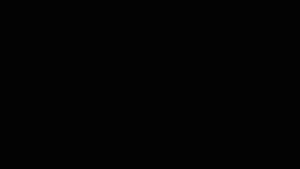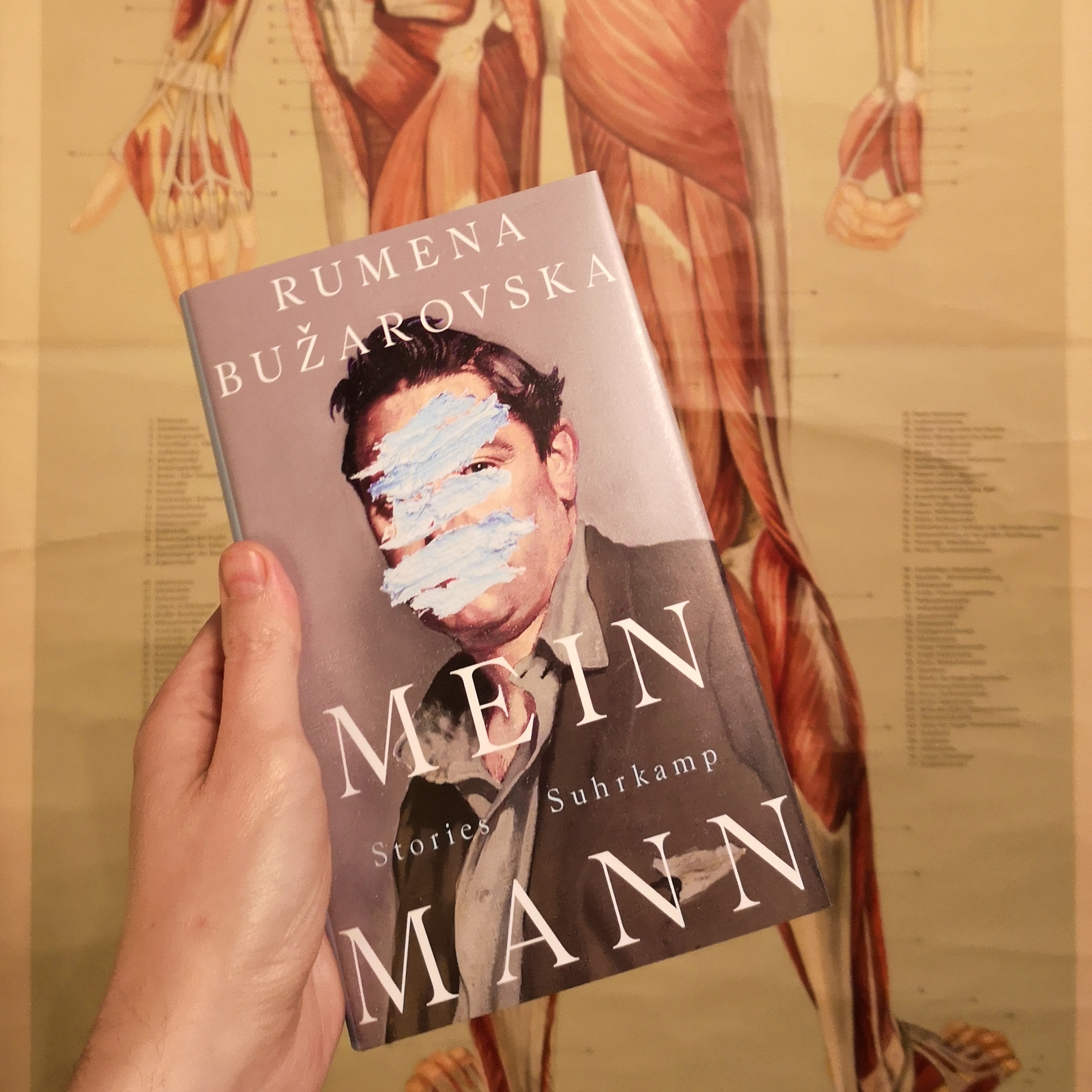
Vor geraumer Zeit hat es sich mein Mann in den Kopf gesetzt, Karriere als Literaturkritiker zu machen. Vermutlich in Folge einer Midlife-Crisis, wie sie Männer seines Alters häufig befällt. Natürlich war die Sache von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nicht einmal die Lokalpresse hatte Interesse daran, seine stümperhaften Buchbesprechungen abzudrucken. Ich heuchelte Mitgefühl, war insgeheim aber wenig überrascht – denn bis heute zwingt er mich dazu, seine laienhaften Ergüsse Korrektur zu lesen und ihnen Verve und intellektuelle Strahlkraft zu bescheinigen. Bleibt mein Lob aus, oder weise ich ihn gar auf Stilblüten oder Logikfehler hin, wird er schnell aufbrausend und ist tagelang gekränkt. Dies tut seinem Geltungsdrang jedoch keinen Abbruch. Da er im echten Journalismus nicht landen konnte, aber weiterhin an seine „Berufung“ glaubt, versucht er sich seit fast drei Jahren als Literaturblogger. Seitdem schlafen wir nicht mehr miteinander.
Da mein Mann immer mehr Bücher heranschafft, platzt unsere kleine Wohnung bald aus allen Nähten. Ständig stolpere ich über einen neuen Stapel lettischer Lyrik oder polnischer Reisereportagen. Dass er dieses abstruse Zeug jemals lesen wird, halte ich für unwahrscheinlich. Sein Interesse für die Literatur Osteuropas nehme ich ihm ohnehin nicht ab. Angeblich möchte er dieser Literatur zu mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit verhelfen. Doch der eigentliche Grund seiner sogenannten Spezialisierung besteht nur im verzweifelten Versuch, von seiner eklatanten Inkompetenz abzulenken: Beschäftigt man sich mit Unbekanntem, fallen die eigenen Unzulänglichkeiten weniger auf. Es fehlen die Vergleichswerte. Alle paar Wochen beschweren sich Autor*innen oder Verlage über seine selbstverliebten Verrisse und pathetischen Lobhudeleien. Da ich seine Post erledige, halte ich diese Briefe vor ihm zurück. Ein gnädiger Akt der Beziehungspflege.
Natürlich ist es nicht mein Mann, der die vielen Bücher im Wohnzimmer vom Staub befreit. Während er sich ganz dem Lesen und Schreiben widmet, putze ich emsig hinter ihm her und besorge den Haushalt. Weil ich seine leeren Wein- und Bierflaschen immer zeitig zum Glascontainer bringe, hält er seinen Alkoholkonsum für unproblematisch. Ruhe ist mir nur dann vergönnt, wenn er das Haus verlässt und durch die Straßen und Museen der Stadt schlendert. Bei dieser Gelegenheit entstehen die schlecht ausgeleuchteten Buchphotos, die er dann auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Vermutlich sucht er den Kontakt zur Jugend, die sich auf dieser Plattform herumtreibt und die nötige Begeisterung für solche Banalitäten aufbringt. Likes und Kommentare machen meinen Mann glücklich und zaubern ein Lächeln auf sein speckiges Gesicht.

Um sich von der „Arbeit“ zu erholen, kocht mein Mann regelmäßig groß auf. Meist nur für uns zwei, da er Freunde und Bekannte durch sein Geschwafel längst vergrault hat. Das Chaos in der Küche muss dann ich beseitigen. Da er sich aber an den reproduktiven Tätigkeiten beteiligt – wie er stets betont, wenn ihn niemand danach fragt –, versteht er sich als Feminist. Gönnerhaft fügt er dann oft hinzu, wie engagiert er sich als Blogger um die Literatur von Frauen bemühe. Gerade erst neulich habe er mir doch das Buch Mein Mann (Suhrkamp Verlag, 2021) der nordmazedonischen Autorin Rumena Bužarovska empfohlen, das von Benjamin Langer ins Deutsche übersetzt wurde. In den elf Short Stories des Bandes erzähle jeweils eine Frau vom mitunter katastrophalen Verhältnis zu ihrem Ehemann. Das müsse mich doch sicher interessieren. Leider hat er recht.
Ich kann mir schon vorstellen, wie das dann wieder laufen wird. Weil er nicht dazu in der Lage ist, ein Buch prägnant zusammenzufassen, wird er in seiner Besprechung mit Wortgruppen arbeiten, die die thematische Bandbreite der Erzählungen einfangen. Erwartbar sind: sexualisierte Gewalt, patriarchale Strukturen und machoides Gehabe, internalisierte Misogynie, Beziehungsverdruss und Ehebruch sowie das Bedauern von Mutterschaft. Mit Lob geht mein Mann grundsätzlich sparsam um. Erwähnen wird er aber den wunderbaren Humor Bužarovskas und ihre Fähigkeit, plumpe Anschuldigungen und Vereinfachungen zu umgehen. Da habe jemand den Foucault’schen Machtbegriff verstanden, wird er sagen und sich dabei selbstgerecht auf die feisten Schenkel schlagen. Beiläufig wird er hinzufügen, dass die Autorin sich hier klar an der amerikanischen Short Story orientiere, aus einigen Erzählungen aber etwas zu früh aussteige.
Und nun wird es für alle Beteiligten so richtig unangenehm. Ob seiner fortgeschrittenen Originalitätssucht wird sich mein Mann bemühen, eine möglichst „gerissene“ Form für sein Palaver zu finden. In gewisser Weise ist es ja rührend, welche Anstrengungen er unternimmt, um seine durchschnittlich drei Leser*innen zu beeindrucken. Er wird sich also mal wieder in eine Art Mimikry versteigen und versuchen, Erzählhaltung und Ton der Prosa Bužarovskas nachzuahmen. Dieser „künstlerische“ Zugang hat einen großen Vorteil: Mein Mann wird letztlich nur wieder über sich selbst reden. Das geht mir höllisch auf die Nerven. Aber es will mir einfach nicht gelingen, mich von ihm zu trennen.