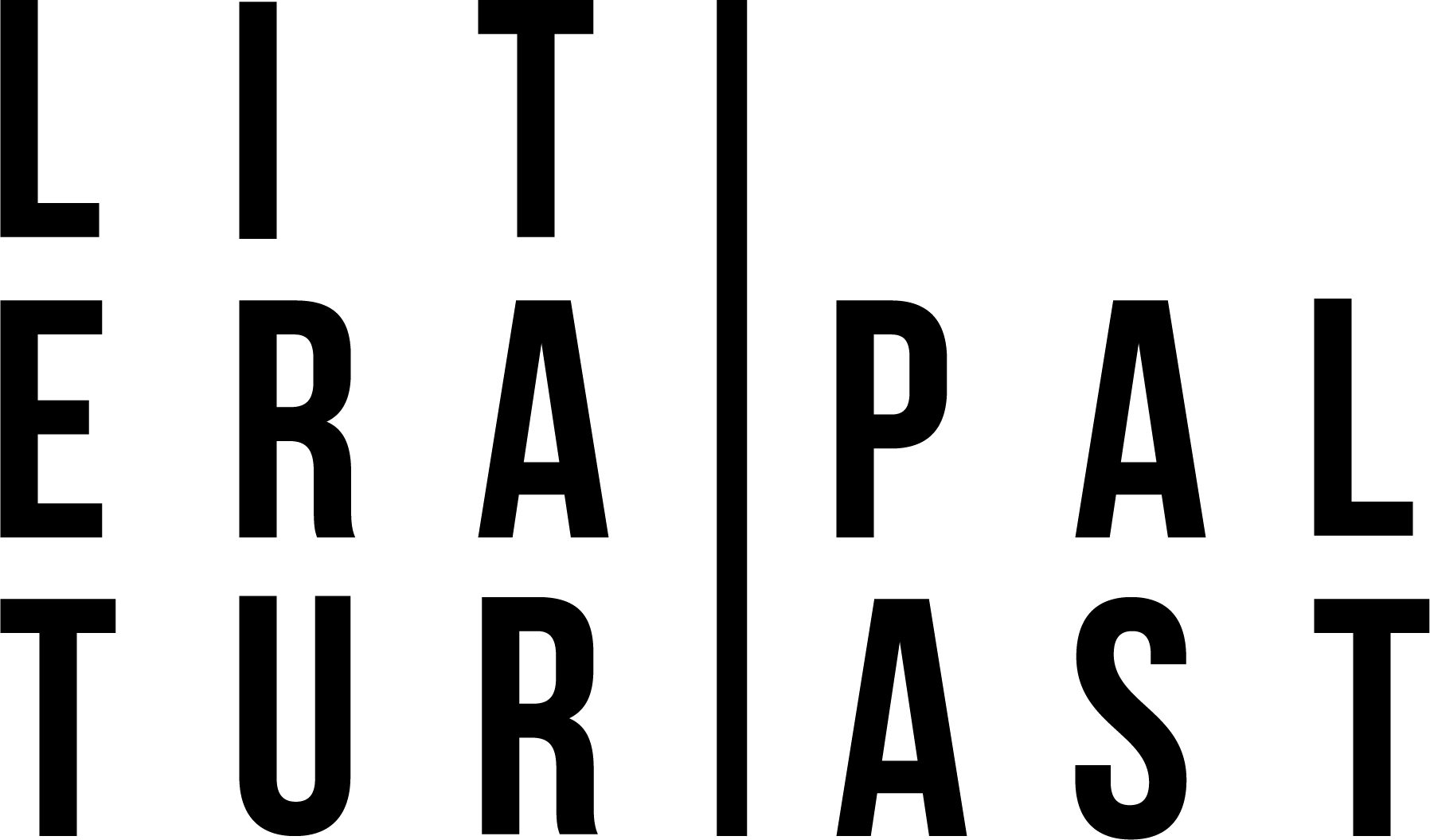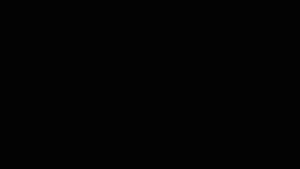”„In diesem Sommer haben wir uns stärker zerstört als in all den Jahren zuvor, aber wir waren nie lebendiger gewesen. Mutter sah aus wie eine Zimmerpflanze, die man auf den Balkon gestellt hatte. Ich sah aus wie ein lobotomisierter Krimineller. Endlich waren wir eine Familie.“
Tatiana ȚîbuleacDer Sommer, als Mutter grüne Augen hatte
Das Haus füllte sich nach und nach mit unnützen Dingen und sah mittlerweile so aus, „als wäre Gott gestolpert und hätte seine Tasche ausgekippt“. Krempel und Plunder, in alle Richtungen verstreut: geblümte Tassen und ein Tonkrug mit Weidenhenkel, eine Nachttischlampe, ein alter Sessel, zwölf tiefe Teller und sechs Wodka-Gläser. Anschaffungen der Mutter. Eine Art Mitgift für ihren siebzehnjährigen Sohn Aleksy, der sie zum Trödelmarkt in der Nähe ihres Ferienhauses begleitet. Er interessiert sich nicht für den Krimskrams, den seine Mutter euphorisch in den Einkaufstrolley stopft. Er folgt ihr aus Sorge, sie könnte wieder in Ohnmacht fallen und zusammenbrechen. All die Dinge, mit denen sie sich umgibt, wird sie nicht mehr gebrauchen können. Sie ist an Krebs erkrankt und bereitet sich auf ihren Tod vor. Ihr Sohn, dem sie nie eine Mutter war, begleitet sie auf dieser letzten Reise in den Norden Frankreichs.
Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte (Schöffling & Co., 2021) der moldawischen Schriftstellerin Tatiana Țîbuleac – aus dem Rumänischen von Ernest Wichner – ist in gleich mehrfacher Hinsicht ein Buch des Übergangs: Der herausfordernde Roman widmet sich nicht nur dem Sterben der namenlosen Mutter und einem gewaltvollen Mutter-Sohn-Verhältnis. Er thematisiert ebenso die Migrationserfahrung einer polnischen Familie in Großbritannien, die im Londoner Stadtteil Haringey mit Ressentiments und Ablehnung konfrontiert wird. Trotz dieses Themenspektrums ist der Roman nicht überfrachtet. Schon deshalb nicht, weil all diese Punkte miteinander verwoben sind und sich einander bedingen.
Aleksy – Protagonist und Ich-Erzähler des Romans – wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Sein alkoholkranker Vater misshandelt ihn, verlässt die Familie für eine andere Frau und nimmt bei dieser Gelegenheit den halben Hausstand mit. Seine Mutter arbeitet im Lebensmittelgeschäft der Großmutter, betrauert den frühen Tod ihrer Tochter Mika und schenkt ihrem Sohn weder Liebe noch Zuwendung. Aleksy wird frühzeitig verhaltensauffällig und gewalttätig, fühlt sich wie menschlicher Abfall und muss therapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen. Der Roman setzt in dem Moment ein, in dem er die Lehranstalt verlässt, die „[s]einen Bedürfnissen besser entsprach“.
Was auf den Schulabschluss folgt, ist die womöglich bitterste Hasstirade der jüngeren Literaturgeschichte: Aleksy wettert gegen die „nutzloseste Mutter, die es je gab. […] Sie umzubringen war mir gerade mal einen halben Gedanken wert.“ Es gibt nur eine einzige Sache, die er an ihr mag: Sie „hatte ein Paar dermaßen schöne grüne Augen, dass es wie ein krasses Versehen aussah, sie auf ein so aufgedunsenes Gesicht zu verschwenden.“ An ihrem Geburtstag bittet ihn seine Mutter jedoch überraschend darum, sie nach Frankreich zu begleiten, wo sie ein Haus gemietet hat. Aleksy wollte den Sommer eigentlich mit zwei Freunden in Amsterdam verbringen, um sich ganz in Sex und Drogen zu verlieren. Ihrem Wunsch gibt er nur deshalb nach, weil sie ihm ihr Auto verspricht.

Von gemeinsamen Sommer mit der Mutter berichtet Aleksy erst zwanzig Jahre später. Sich rückblickend – und ohne zu moralisieren oder sich in falsches Mitleid zu verlieren – mit dem Tod der Mutter, aber auch mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen, geht auf eine Initiative seines Psychiaters zurück. Während die Passagen über die gemeinsame Zeit in Frankreich weitestgehend einer klassischen Chronologie folgen, lassen sich die vielen Vor- und Rückblicke, von denen das Buch durchsetzt ist, als erratisch bezeichnen. Bruchstückhaft erzählen sie von der Kindheit des Protagonisten, von seiner psychischen Beeinträchtigung, von seiner Karriere als Maler und von einem Unfall, der Aleksy an den Rollstuhl bindet. Die vielen kleinen Unterkapitel des Romans ergeben zu keiner Zeit ein kohärentes, von Widersprüchen befreites Ganzes. Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte arbeitet mit Brüchen, Leerstellen und Inkongruenzen. Gerade darin liegt die Stärke der literarischen Komposition.
Der Roman von Tatiana Țîbuleac ist gleichsam ein Buch der Annäherung. Mit fortschreitender Krebserkrankung, von der Aleksy erst in Frankreich erfährt, verschiebt sich das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. „Warum hatte Mutter nicht schon früher zu sterben begonnen?“, fragt sich Aleksy, denn in genau demjenigen Moment, in dem sie immer schwächer, dünner und hilfsbedürftiger wird, wird sie ihm zur besten Mutter, die er je hatte. Nach einem Wannenbad, bei dem sie fast stirbt, kommt sie an seiner Brust wieder zu sich und japst wie ein Säugling, wird ihrem Sohn zur Tochter.
Aleksys Blick auf die Welt verändert sich. Gegenüber seiner Mutter – die ihm immer schöner erscheint – zeigt er sich nachsichtiger, flucht weniger und hört besser zu. Er beginnt, Mitleid mit ihr zu empfinden – nicht weil sie sterben muss, sondern weil ihr die eigene Geschichte abhanden gekommen ist. In den langen Gesprächen mit ihrem Sohn fühlt sie sich genötigt, zu lügen und ihre Vergangenheit zu verfälschen. Er kann es ihr nicht verdenken, denn „Erinnerungen gibt es, wie all die anderen guten Dinge, nicht umsonst. Wohingegen wir – sie und Vater und ich – stets Geizkragen waren und es immerzu vorgezogen hatten, die Dinge in uns reinzufressen, statt sie Erinnerungen zu überlassen.“
Am Ende vergibt Aleksy seiner Mutter, doch mit dem Leben selbst kann er sich nicht versöhnen. Die Augenfarbe der Mutter verspricht den Leser*innen des Romans eine Zuversicht und Hoffnung, die der Protagonist Aleksy jedoch völlig verloren hat. Sein Scheitern ist absolut. Kontrastiert wird dieses Scheitern von den leuchtenden Sprachbildern, die Țîbuleac in ihrem Text entwirft. Eine Poetik der Grausamkeit.