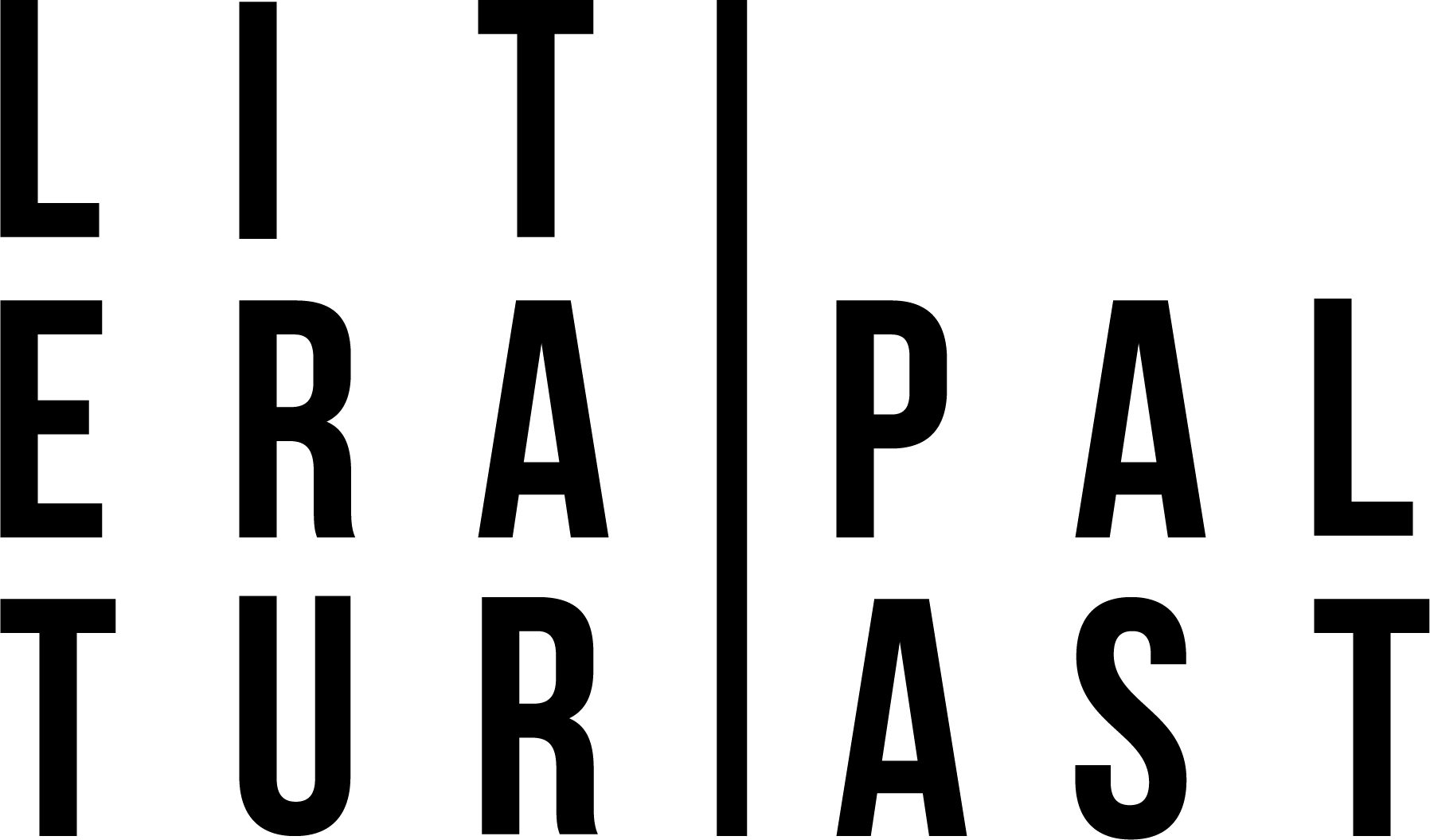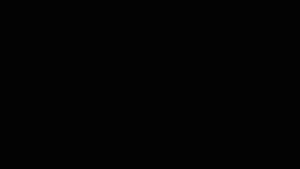Über den tatsächlichen Umfang des Schriftverkehrs von Christa Wolf (1929-2011) kann auch dessen Verwalterin nur Mutmaßungen anstellen. Sabine Wolf, Leiterin des Literaturarchivs der Berliner Akademie der Künste und nicht verwandt mit der Autorin, geht aber davon aus, dass über einen Zeitraum von mehr als sechzig Jahren etwa fünf Briefe pro Woche entstanden. Daraus ergibt sich grob geschätzt eine Gesamtanzahl von rund 15.000 Schriftstücken, die für den Band Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten. Briefe 1952-2011 (Suhrkamp Verlag, 2016) durchgesehen und evaluiert wurden. Von dieser kaum überschaubaren Menge an Material wurden letztlich „nur“ 483 Briefe in die über 1000 Seiten umfassende Edition aufgenommen, was ganz zwangsläufig die Frage aufwirft, unter welchen Kriterien die Auswahl erfolgte.
Zu diesem Punkt nimmt die Herausgeberin im Nachwort des Buches ausführlich Stellung. Entscheidend waren für sie „nicht in erster Linie die Prominenz der Korrespondenzpartner, sondern die Funktion eines Briefes innerhalb des Bandes, bei dem die Briefschreiberin im Zentrum steht, ihre Lebens- und Gedankenwelt, die Facetten ihres Ausdrucks, ihre Literatur, ihre familiäres und gesellschaftliches Umfeld, ihre Zeit.“ Kurzum: Es wurde sich dafür entschieden, aus dem vorhandenen Material eine Lebenserzählung in Briefen zu komponieren, die sich – da ausschließlich Wolfs eigene Texte, nicht aber diejenigen ihrer Briefpartnerinnen und -partner Eingang in die Sammlung fanden – wie eine posthume Autobiographie liest.
Über den Wert der vorliegenden Edition als zeithistorische Quelle lässt sich kaum streiten. Sie gewährt detaillierte Einblicke nicht nur in das Leben der wohl bedeutendsten Schriftstellerin der DDR, sondern ebenso in die gesellschaftlich-politischen Entwicklungen des ostdeutschen Staates. Ermöglicht wird dies einerseits durch die weitreichende Vernetzung der Autorin im ostdeutschen Kulturbetrieb und andererseits durch das spezifische Autorinnen-Verständnis Christa Wolfs. Denn als sozialistische Schriftstellerin sah sie sich stets in der Pflicht, die maßgeblichen Debatten ihrer Zeit entweder zu kommentieren oder aber direkt darin einzugreifen und persönlich Verantwortung zu übernehmen.
Diesen Eifer belegt bereits der erste im Band publizierte Brief vom April des Jahres 1952. Darin bietet sich die 23-jährige Germanistik-Studentin der SED-Tageszeitung Neues Deutschland als redaktionelle Mitarbeiterin an, um den „wiederholten Forderungen nach einer gründlichen Kritik unserer zeitgenössischen Literatur“ nachzukommen, der allgemeinen „Verbildung des Geschmacks“ entgegenzuwirken und sich aktiv am Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft zu beteiligen. Ihr unbedingter Glaube an das sozialistische Projekt, dessen „Gesetzesmäßigkeit“ sie noch im Jahr 1962 betont, sollte jedoch in den Folgejahren auf eine harte Probe gestellt werden.
Nachdem es bereits auf dem VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei zu groben Verunglimpfungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern kommt, gegen die Wolf energisch Beschwerde einlegt, tritt sie nur wenig später – auf dem 11. Plenum des ZK der SED im Jahr 1965, das als „Kahlschlagplenum“ in die Geschichte eingegangen ist – als einzige Rednerin gegen die restriktive Kulturpolitik der DDR in Erscheinung. Spätestens nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 schleicht sich ein von Resignation getragener Tonfall in ihre Briefe ein, der sich mit den Jahren immer mehr verstärkt.
Auf dem Höhepunkt der Kontroverse um die Biermann-Ausbürgerung im Jahr 1976 kann Wolf gegenüber Maxie Wander „nicht mehr verhehlen, dass ich zwischen allen Stühlen sitze und dass es so bleiben wird.“ Nachdem auch ihre gute Freundin Sarah Kirsch in den Westen gegangen ist, schreibt sie entmutigt: „Es wird so leer, man fängt an zu frieren. Sie wird mir fehlen, nicht nur mir.“ In der Folge tritt Christa Wolf von sämtlichen kulturpolitischen Ämtern zurück und vermeidet über Jahre hinweg größere öffentliche Auftritte.
Ihre einstige Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz keimt erst wieder in den Wendejahren auf, in denen sie sich skeptisch zu den raschen Wiedervereinigungsplänen der Bundesregierung äußert und sich stattdessen für einen „dritten Weg“ einsetzt. Doch schon Mitte Dezember 1989 muss sie sich eingestehen, dass eine „sozialistische Alternative“ keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Gleichsam schwindet zu Beginn der 1990er Jahre ihre Integrität als moralische Instanz und engagierte Intellektuelle. Und zwar in dem Moment, in dem bekannt wird, dass sie nicht nur ein Opfer des ostdeutschen Überwachungsapparates war, sondern in den späten 1950er Jahren selbst für kurze Zeit als „IM Margarete“ beim Ministerium für Staatssicherheit geführt wurde.
Diese Enthüllung kam auch für Wolf überraschend. Dem Schriftsteller Walter Kaufmann, über den sie ihren einzigen – in keiner Weise denunziatorischen – Rapport für die Stasi verfasst hat, schreibt sie: „Ich wäre froh, wenn du mir glauben könntest, dass ich die ganzen Jahre über, seit wir uns kennen, die Tatsache, dass ich diesen Bericht geschrieben habe, vergessen, das heißt, verdrängt hatte.“ Noch in ihrem letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Roman Stadt der Engel aus dem Jahr 2010 geht sie den wirkungsmächtigen Mechanismen nach, die sie diese Phase ihres Lebens hatten ausblenden lassen.
Es ist die große Stärke der Briefedition, dass sie die bemerkenswerte Vita Christa Wolfs durch mitunter schonungslose Selbstbefragungen zu beleuchten vermag. Darüber hinaus verfügt der Band über einen ausgezeichneten Anmerkungsapparat. Doch sind Korrespondenzen – zumal diejenigen bekannter Schriftstellerinnen und Schriftsteller – ausschließlich als historisches Dokument von Interesse? Gewiss nicht. Vielleicht noch stärker von Belang als der eigentliche Inhalt sind hier Kunstfertigkeit und Stil, Intensität und Tiefe.
Auf dieser Ebene jedoch wissen Wolfs Briefe kaum zu überzeugen. Denn das Gros der versammelten Schriftstücke fällt wohl oder übel unter die Kategorie des Gebrauchstextes, einzig verfasst, um Informationen zu übermitteln. Und so gewichtig einige dieser Auskünfte auch sein mögen – die Sprache Christa Wolfs ist es nicht. Sie bleibt erstaunlich leblos. Damit offenbart sich ein harter Bruch zwischen der versierten Romanautorin und der getriebenen Briefeschreiberin, die es sich zeitlebens zur Aufgabe machte, jeden einzelnen an sie gerichteten Leserbrief zu beantworten. Nicht zuletzt diesem protestantischen Eifer ist es geschuldet, dass sich Wolfs Schriftverkehr eher durch seine Quantität denn durch seine literarische Qualität auszeichnet.

Eine frühere Version dieses Textes erschien 2017 in der Zeitschrift Wespennest.