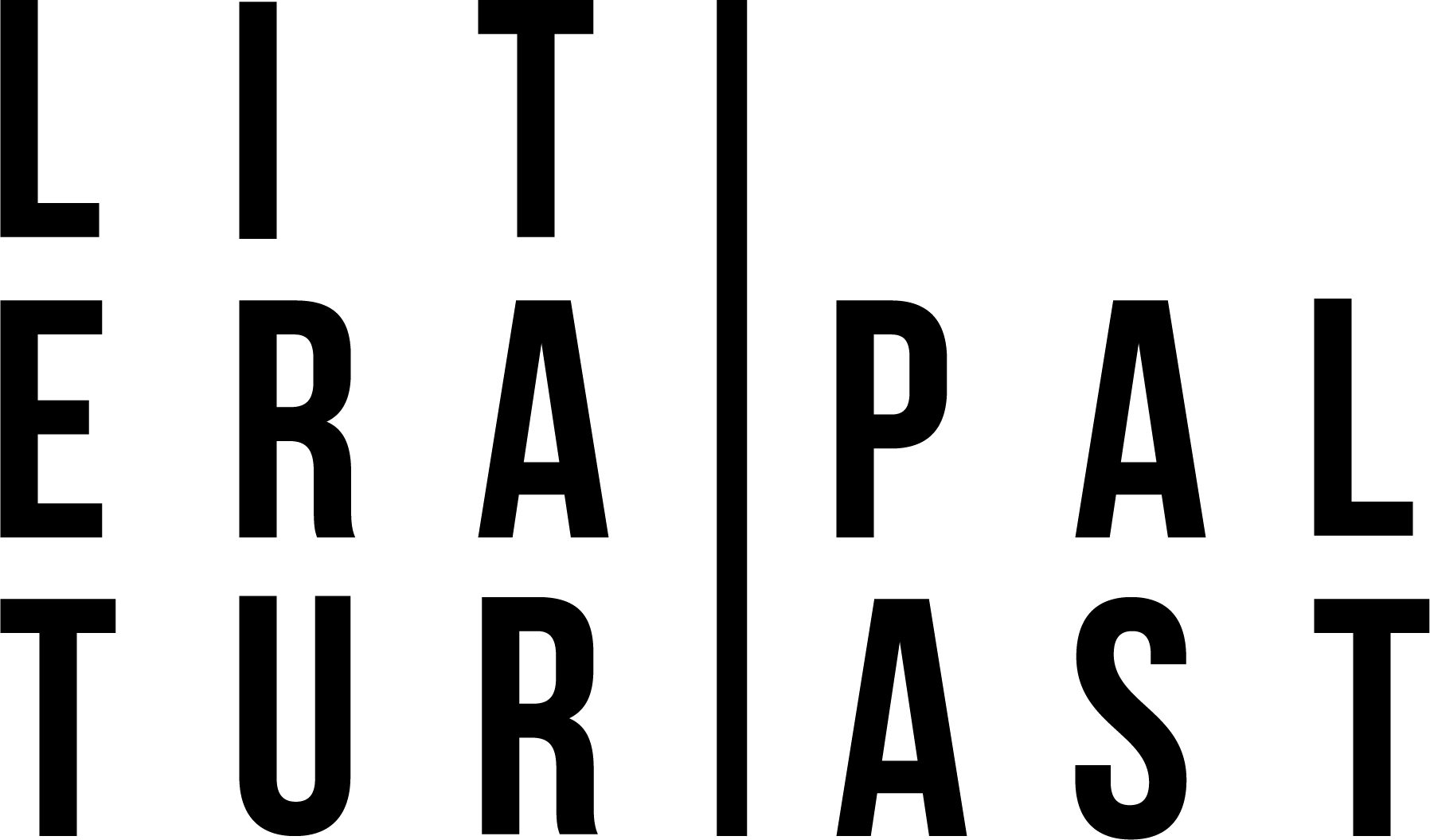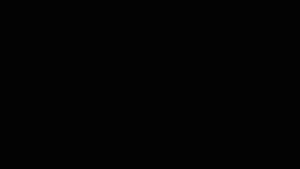Sehr geehrter Steffen Mau,
angesichts der aktuellen Situation sollten wir ein persönliches Gespräch über Ihr Buch Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft (Suhrkamp Verlag, 2019) wohl besser vertagen. Damit sind Sie doch einverstanden? Anstelle einander zu treffen schreibe ich Ihnen also einen Brief. Nun mögen Sie einwenden: „Als sogenannter #bookstagramer werden Sie sehr wahrscheinlich über ein funktionstüchtiges Telefon und einen Internetzugang verfügen. Selbst in Wien wird man schon von Skype gehört haben, nehme ich an.“ Da kann ich Ihnen unmöglich widersprechen, Herr Mau. Und dennoch möchte ich auf der hier gewählten Form der Kontaktaufnahme bestehen. Verstehen Sie sie bitte als einen Akt der Solidarität mit den 84 Prozent aller ostdeutschen Haushalte, die im Jahr 1989 über kein eigenes Telefon verfügten. Das finden Sie affektiert und hanebüchen? Ja, mag sein – passt damit aber ganz gut zur viel beschworenen Solidarität und Völkerfreundschaft, mit der es in der DDR ja auch nicht weit her war. Das erläutern Sie sehr schön in Ihrem Buch, das glücklicherweise sehr viel besser geschrieben ist als der holprige Einstieg meines Briefes.
Ihr Buch ist nicht nur gut geschrieben – es bietet auch eine kurzweilige und kompakte Einführung in die Themen DDR und Nachwendezeit. Aus diesem Grund ist es gerade jüngeren Leserinnen und Lesern zu empfehlen. Doch auch alle anderen werden Ihre soziologische Untersuchung mit Gewinn lesen. Denn Ihre Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Frakturen Ostdeutschlands macht nicht nur deutlich, warum sich die ostdeutsche Gesellschaft auch 30 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung so entschieden von der westdeutschen unterscheidet. Sie legen ebenso plausibel dar, warum sich an dieser Situation auch zukünftig nur wenig ändern wird. Seien Sie aber unbesorgt, ich werde ihre detailreichen Schilderungen der nivellierten, geschlossenen und ethnisch homogenen Werktätigengesellschaft der DDR hier nicht vorwegnehmen. Lassen Sie mich stattdessen ein wenig mosern – das liegt in meinem ostdeutschen Naturell:
So sehr mir Ihr Buch gefällt, bin ich doch der Meinung, dass Ihnen Ihre wissenschaftliche Sorgfalt (oder: Ihr akademisches Naturell) mitunter im Weg steht. Und dies in zweierlei Hinsicht: Sie möchten nicht spekulieren. Daher sind Sie zögerlich mit Aussagen zur aktuellen politischen Situation im Osten. Zwar liefern Sie zahlreiche Hinweise und Erklärungsmuster für den Aufstieg des Rechtspopulismus (gerade) in der ehemaligen DDR – dabei zurecht betonend, dass „verstehen“ und „Verständnis“ zwei unterschiedliche Paar Schuh sind – lassen jedoch Vorsicht walten, wenn es um konkrete Handlungsanweisungen geht. Ihre Zurückhaltung in dieser Frage (zudem nicht Hauptaugenmerk Ihrer Untersuchung) artikulieren Sie am Anfang Ihres Buches sogar selbst.
Der „Homo academicus“ in Ihnen kommt aber auch der Anlage und Form Ihrer Arbeit in die Quere. Zwar haben Sie sich für einen persönlichen Zugang entschieden und berichten immer wieder vereinzelt aus Ihrem eigenen Leben – Lütten Klein, ein DDR-typisches Neubaugebiet zwischen Rostock und Warnemünde, ist der Ort Ihrer Kindheit und Jugend –, verfolgen diesen Ansatz aber nicht mit der nötigen Konsequenz. Allzu sehr wollten Sie Ihrem französischen Kollegen Didier Eribon dann eben doch nicht nacheifern. Ihr Buch ist kein Memoir und das ist auch Ihr gutes Recht. Die lose gestreuten autobiographischen Elemente lockern Ihren Text auf, aber sie bleiben Anekdoten. Für einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn sorgen sie nicht. Diesen gewährleisten Sie auf klassisch wissenschaftlichem Wege.
Gerade den zweiten Teil Ihres Buches, der sich mit der Nachwendezeit und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik auseinandersetzt, empfand ich als große Bereicherung. Das hat auch damit zu tun, dass ich selbst in der DDR geboren wurde. Ich bin zwar nicht in einer „Fickzelle mit Fernheizung“ aufgewachsen – so nannte Heiner Müller die ostdeutschen Neu- bzw. Plattenbauten –, komme aber aus einer Familie, die der sogenannten „Normalbevölkerung“ zuzurechnen ist. Wenn Sie also von der Standardisierung familiärer Lebensformen, der großen Ähnlichkeit der Lebenswege und der relativen Gleichheit der Lebensverhältnisse schreiben, dann verstehe ich Sie sofort.
Die rauschhafte Hoffnung auf Veränderung, die das Umschlagen subjektiver Ohnmacht in kollektive Handlungsmacht in den Jahren 89/90 mit sich brachte, ist aufgrund meines damaligen Alters jedoch an mir vorbeigezogen. Ich erinnere mich nur mehr an die Resignation der Folgejahre, ausgelöst von der Massenarbeitslosigkeit und vom Zerfasern der einstmals arbeitszentrierten Gesellschaft. Davon betroffen war auch meine eigene Familie, in der Existenzsorgen und Hilflosigkeit vorherrschten. Und so wurde ich Teil der „Generation der Unberatenen“, die weitestgehend auf Eltern als Wegweiser, Türöffner und letztlich auch als finanzielle Unterstützer verzichten musste, da Vermögensakkumulation in der DDR kaum eine Rolle spielte. Aber sehen Sie, ich mag hier gar nicht in Selbstmitleid verfallen – schon weil es meiner Familie und mir heute sehr gut geht. Zudem bin ich guter Hoffnung, dass das auch zukünftig so bleiben wird. Und so möchte ich mich ganz herzlich für Ihre erhellende Arbeit bedanken und Ihnen alles Gute wünschen.
Mit den besten Grüßen aus Wien
Tino Schlench