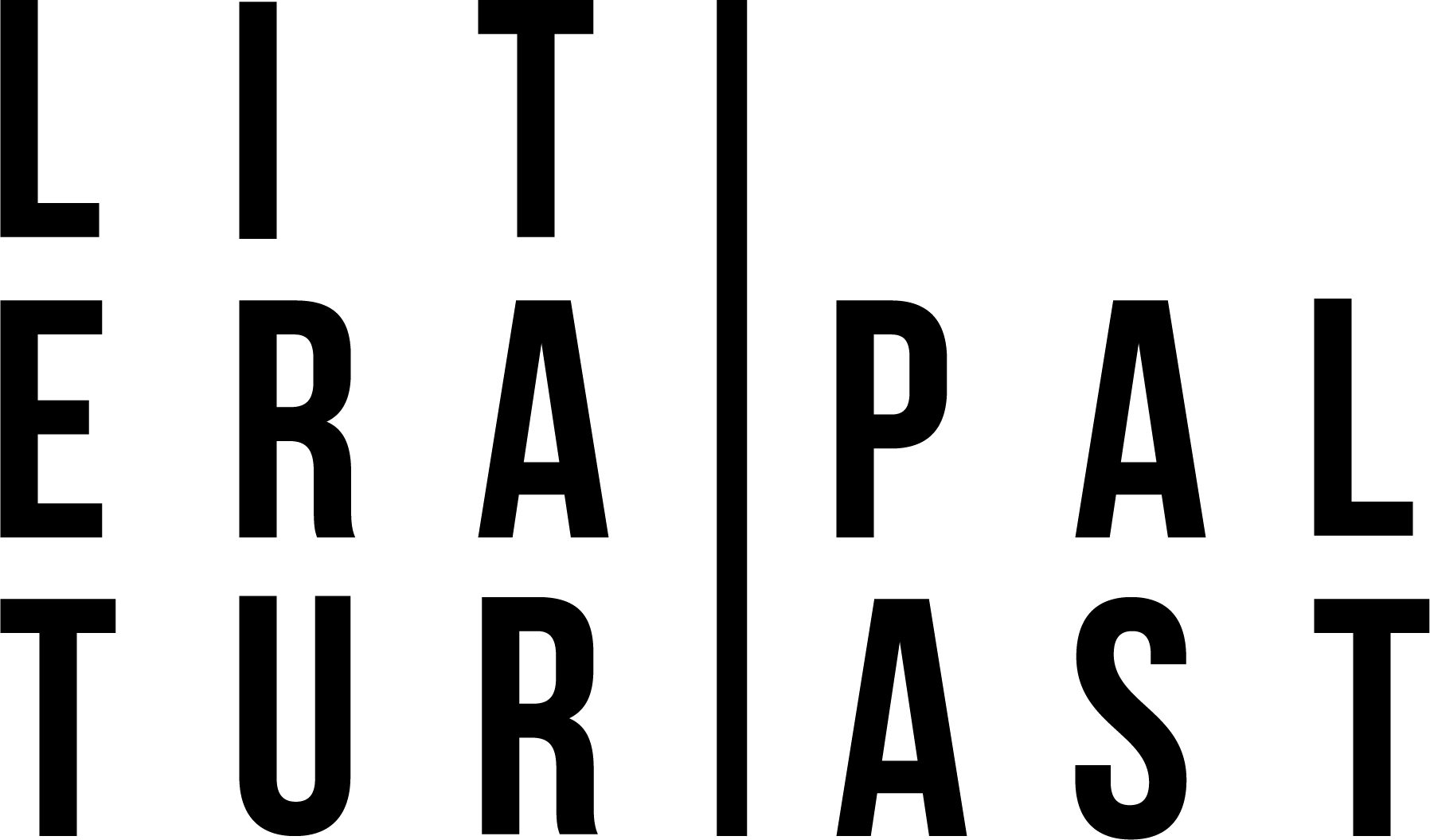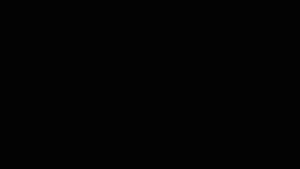Da hast du nun, ach! Said, Hall und Spivak, und leider auch Bhabha durchaus studiert, mit heißem Bemühn! Und stehst nun da, du armer Tor, nicht unklug, nein, gewiss nicht, nein. Allein, Magister oder Doktor kannst du dich nicht heißen. Wohlan, Herr Student! In kleinen Schritten voran. Herauf, herab und quer und krumm – so wandert dein Blick übers Bücherregal. Mag schon sein, dass wir nichts wissen können. Aber du kannst doch wenigstens so tun. Eine Hausarbeit im Seminar „Postkoloniale Literaturanalyse“ schreibt sich nun wirklich nicht von selbst, Herrschaftszeiten! Fang. Endlich. An.
Den Rushdie und den Kipling beackern natürlich schon die anderen Laffen. Das war klar. Aber schau dir doch mal einen Text an, der sich weniger aufdrängt, aber ebenso interessant ist. Versuch’s mit der Erzählung Brüder des russischen Autors Iwan Bunin (1870-1953), Literaturnobelpreisträger des Jahres 1933. Bunins Auseinandersetzung mit den kolonialen Verhältnissen in Ceylon – dem heutigen Sri Lanka – findest du im Band Ein Herr aus San Francisco. Erzählungen 1914/1915 (Dörlemann Verlag, 2017), übersetzt von Dorothea Trottenberg. Eine insgesamt lohnende Lektüre, die zumeist ins bäuerliche Russland führt. Ausnahmen sind die titelgebende Erzählung, die in Italien spielt und in gewisser Weise an Thomas Tod in Venedig erinnert, und die besagten Brüder, die uns mit einem singhalesischen Rikschafahrer in Colombo bekannt machen. Geschwister gibt es darin freilich nicht. Stattdessen geht es um die brüderlichen Verhältnisse aller Menschen zueinander, die hier mit Füßen getreten werden. Das erklärt dir das Nachwort von Thomas Grob, bei dem du dich bedanken solltest.
Tauch also ab in eine Erzählung, die trotz aller guten Intentionen die Zeitgebundenheit des Verfassers fortlaufend zu erkennen gibt. Und schnapp dir deine alte Paperback-Ausgabe von Orientalism und gleiche ab: Hier tragen die Engländer weiße Smokings und verfügen über einen „festen, unbeugsamen Gang, wie ihn nur Europäer haben“. Die indigene Bevölkerung aber ist „nahezu schwarz, sehr mager und unansehnlich“. Die Frauen zeigen sich allesamt schwach – die Männer sind frauenhaft, eunuchengleich und krank. Klassische Dichotomien, die noch immer in den Köpfen schweben. Aber muss ich dir denn alles vorkauen, Herr Student? So eine Hausarbeit ist ja kein faustisches Vorhaben. Also: Fang. Endlich. An.