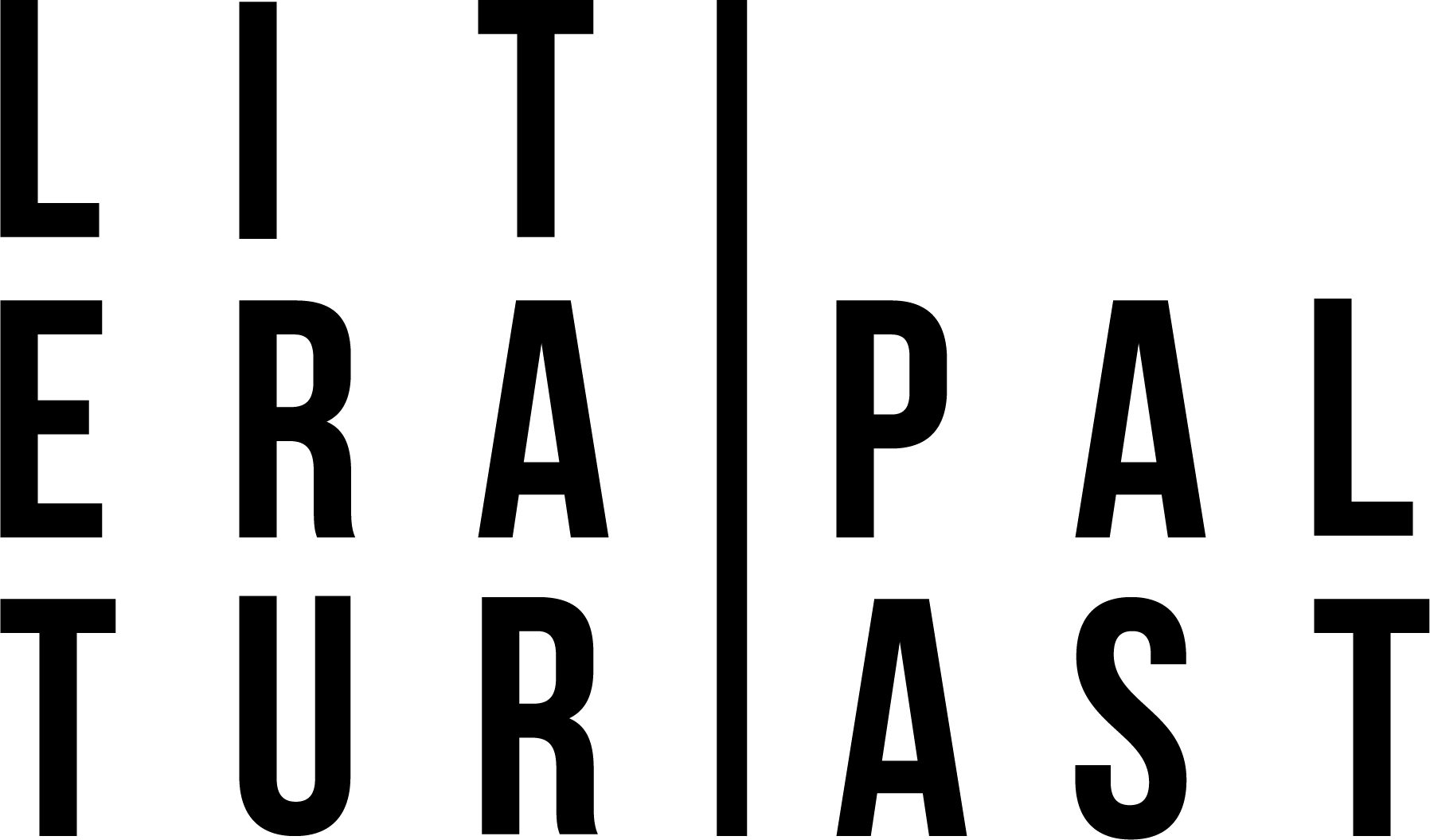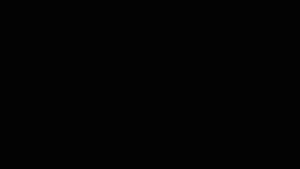Stepanzminda
„I can see Russia from my house!“ Nun, zumindest bei gutem Wetter. Denn reist man nach Stepanzminda am Fuße des Kasbek-Berges (5047 Meter Höhe) im Großen Kaukasus, dann ist Russland nur mehr wenige Kilometer entfernt. Die Autofahrt in den Norden Georgiens gestaltet sich jedoch etwas anstrengend. Denn nach Russland führt nur eine einzige Straße, die vollkommen überlastet ist (was in Georgien wiederum keine Seltenheit darstellt). Mitunter fahren hier auf einspurigen Fahrbahnen schon mal drei Autos und/oder LKW gleichzeitig nebeneinander. Überholmanöver inklusive, trotz Serpentinen. Auch Kühe gesellen sich dann und wann dazu. Ein wenig musste ich zittern.
Unverkennbar verweist die Ich-Erzählerin des Romans auf dessen Autorin. Weil sie sich weigerte, Spitzeldienste für den rumänischen Geheimdienst zu verrichten, wurde Herta Müller jahrelang bedroht und schikaniert. 1987 gelang die Ausreise nach Deutschland. Wie in den meisten ihrer Romane, setzt sich Müller auch in „Heute wär ich mir lieber nicht begegnet“ mit den Auswirkungen der Diktatur auf das Individuum auseinander. Dabei bedient sie sich einer Sprache, die in Stil und Tonart unverwechselbar ist. Objekte und Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs verschmelzen darin zu poetisch-präzisen Bildern und Metaphern, die nie überladen wirken. Dass es Müller bei aller Ernsthaftigkeit ihres Sujets gelingt, auch heitere und grotesk-humorvolle Episoden einzuflechten, macht ihren Roman umso lesenswerter.
Entlohnt wird man vor Ort mit einer wunderschönen Aussicht auf die Gergetier Dreifaltigkeitskirche, ein beliebtes Postkartenmotiv. Und zwar zurecht. Aufgrund meiner fußlahmen – oder anders formuliert: stinkfaulen – Begleitung, erklomm ich die Anhöhe mit dem georgisch-orthodoxen Kirchenkomplex nicht zu Fuß, sondern motorisiert. Und staune noch immer über den funktionstüchtigen Allradantrieb des Autos und über die Waghalsigkeit meiner Begleitung am Steuer. Stets in meinem Handgepäck: die pure Todesangst. Aber gut, nichts gegen meinen phlegmatischen Mitreisenden. Der wollte im Anschluss unbedingt im luxuriösesten Hotel des Ortes absteigen und hat mich (so gut wie) eingeladen. Zwar bin ich am nächsten Morgen viel zu früh aufgewacht, doch nutzte ich die Gunst der Stunde und war der erste Gast im Pool. Der Ausblick auf die Kirche beim Schwimmen, während nebenher einer meiner liebsten Popsongs aus den späten 90ern lief: eine meiner schönstes Erinnerung an meinen Aufenthalt in Georgien.
Das Josef-Stalin-Museum in Gori
Wäre sie nicht der Geburtsort Josef Stalins, hätte außerhalb Georgiens wohl kaum jemand je von der Stadt Gori gehört. Keine 100 Kilometer entfernt von Tiflis, etwa 50.000 Einwohner. Ein unscheinbarer Ort. Einigen Straßenzügen sind die Folgen der russischen Luftangriffe während des Kaukasuskriegs im August 2008 noch deutlich anzusehen. Damals starben allein in Gori mindestens elf Zivilisten, viele weitere wurden verletzt. Der Krieg um die Region Südossetien, der insgesamt über 850 Tote forderte, zeigt sich hier weniger durch zerstörte Häuser, Straßen oder Plätze, als durch den gespenstisch-disneyhaften Wiederaufbau der Stadt. Viele „Altbauten“ Goris sind nicht alt. Das ist unübersehbar.
Größte Touristenattraktion des Ortes ist das Josef-Stalin-Museum, das mit Unterbrechung seit 1957 existiert. Ob der Begriff „Museum“ wirklich angemessen ist, darüber lässt sich streiten, denn dem berühmtesten Sohn des Landes wurde in Gori ein Tempel errichtet. Unkritisch und geschichtsverherrlichend nähert sich das Haus seinem Sujet. Hier lebt (wenn auch in abgeschwächter Form) der Personenkult fort. Der Große Terror, politische und ethnische Säuberungen, Millionen Opfer, deren Tod Stalin zu verantworten hat – all das wird in der Ausstellung weitestgehend ausgeklammert. Stattdessen: unzählige Objekte, die auch nur irgendeinen Bezug zum sowjetischen Diktator aufweisen. Das Teeservice seiner Mutter zum Beispiel, nebst vielen anderen Devotionalien. Mehr davon gibt es im Museums-Shop: Tassen, Kugelschreiber, Weinflaschen oder T-Shirts mit dem Konterfei Stalins. Fragwürdige Souvenirs.
Die Höhlenstadt Uplisziche
Die Höhlenstadt Uplisziche hat reichlich wenig mit dem sogenannten Museum über/für den sowjetischen Diktatur Josef Stalin zu tun – besucht aber habe ich sie noch am gleichen Tag. Denn die Festungsanlage liegt in der unmittelbaren Umgebung von Gori auf einem Plateau am Fluss Mtkwari (Kura). Gegründet im 6. Jahrhundert v. Chr., wurde Uplisziche im 13. Jahrhundert n. Chr. durch die Mongolen zerstört und gehört mittlerweile zum UNESCO-Kulturerbe. Gut erinnere ich mich an das sonnige Wetter, den schönen Ausblick auf die Flussebene und die vielen Menschen aus Russland und dem Iran.
Generell gilt: Im Land begegnet man vornehmlich Touristinnen und Touristen aus Russland sowie aus den benachbarten Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Europäische Besucherinnen und Besucher gibt es hier nur wenige, wiewohl sich dies in den vergangenen Jahren ein Stück weit verschoben hat. Georgien erhält zur Zeit deutlich mehr Aufmerksamkeit Dennoch wurde ich auf meiner Reise häufig nach einer Begründung meines Aufenthalts gefragt. Warum, weiß ich bis heute nicht. Denn die Menschen in Georgien sind stolz auf ihr Land und halten es für das schönste der ganzen Welt.
Die Höhlenstadt Wardsia
Nach Wardsia zu fahren, war die Idee eines litauischen Freundes, den ich in der Nationalbibliothek in Tiflis kennengelernt habe. Aber wollte ich wirklich noch eine Höhlenstadt Georgiens erkunden? Na klar doch. Denn Wardsia, ganz im Süden des Landes gelegen, gilt als die eindrucksvollste unter ihnen, was ich hiermit bestätigen möchte. Geplant als Grenzfestung gegen die Perser und Türken, wurde die Stadt am Ende des 12. Jahrhunderts erbaut, doch nur für nur kurze Zeit bewohnt. Denn wenig später, im Jahr 1283, bereitete ein Erdbeben dem Ganzen ein Ende. Und so labt man sich seitdem an den Ruinen.
Zurück in unsere Herberge ging es mit dem Taxi, da diese Art der Fortbewegung in Georgien nicht nur praktisch, sondern auch sehr günstig ist. Ebenso praktisch: Russischkenntnisse (die ich nicht vorweisen kann). Unser Taxifahrer hat auf dem Weg allerdings so viel Geschichtsrevisionistisches von sich gegeben, dass meinem litauischen Begleiter, der der russischen Sprache mächtig ist, bald die Ohren glühten. Ab und an ist es eben doch von Vorteil, keine Ahnung zu haben.